Beim E-Voting ist der Schwyzer Regierung das Risiko zu gross
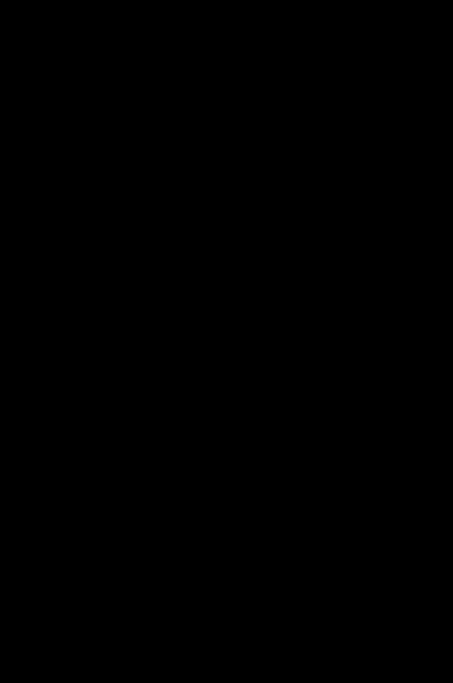
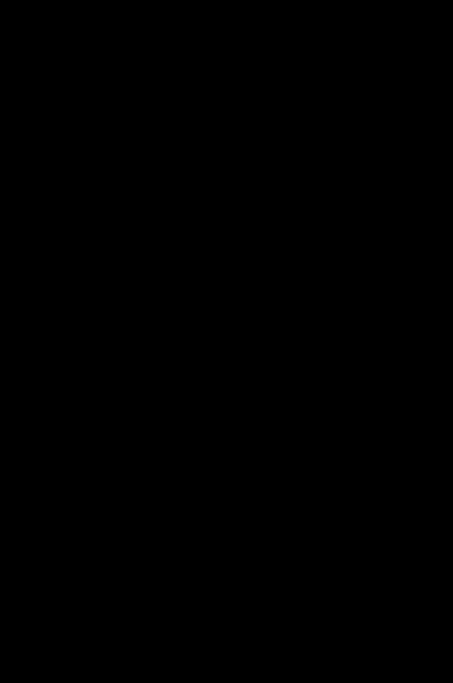
Der Bund soll mit der Digitalisierung dort vorwärtsmachen, wo es sinnvoll sei.
JÜRG AUF DER MAUR
Die Schwyzer Regierung ist gegenüber E-Voting, also der Möglichkeit, die Stimme statt an der Urne digital abzugeben, weiterhin skeptisch. Sie wünscht sich darüber eine Volksabstimmung. Das zeigt die Vernehmlassung, welche die Schwyzer Regierung vor Kurzem an die Bundeskanzlei in Bern einsandte.
Die Vernehmlassung des Bundes läuft noch bis in den August. Der Bund will, dass die Kantone in begrenztem Umfang wieder E-Voting-Versuche durchführen können. Gemäss seinem Vorschlag sollen nach den bisher gescheiterten, pannenbehafteten Versuchen neue Anforderungen gelten und insbesondere sicherheitsfördernde Massnahmen umgesetzt werden.
Für Schwyz sei das Restrisiko zu gross «Die vorliegende Neuausrichtung des Versuchsbetriebs und die damit verbundene Teilrevision lehnen wir ab», heisst es klipp und klar in der Vernehmlassungsantwort, die von Schwyz an Bundeskanzler Walter Thurnherr geschickt wurde. Grund: Schwyz sei aus «politischen und finanziellen Gründen» grundsätzlich gegen die Einführung von E-Voting. Damit bestärkt Schwyz die Position, welche sie schon beim Start der ersten E-Voting-Versuche 2016 vorbrachte.
Seither hätten verschiedene Vorkommnisse, wie etwa die entdeckten Schwachstellen bei der Offenlegung des Quellcodes der Post oder die definitive Einstellung des Genfer E-Voting-Systems, die Haltung der Schwyzer Regierung noch bestärkt.
«Nach unserer Auffassung darf ein Wahl- oder Abstimmungsergebnis nur akzeptiert werden, wenn Manipulationen ausgeschlossen werden können», sagt denn auch der Schwyzer Staatsschreiber Mathias Brun.
Weil aber mit E-Voting immer ein Restrisiko bestehe und deshalb auch Manipulationen nie vollkommen ausgeschlossen werden könnten, habe Schwyz eben grundsätzliche Bedenken. Die vorliegende Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zeige deutlich, dass das Restrisiko nur mit einer anspruchsvollen Regulierung und hohen Kosten reduziert, aber nie ganz ausgeschlossen werden könne.
Der Bund soll, wenn schon, dort Erfahrungen mit der Digitalisierung sammeln, wo sie «keinen grösseren Schaden verursachen kann», heisst es weiter in der Schwyzer Vernehmlassungsantwort.
Staatsschreiber reichten Verbesserungsideen ein Ein gutes Beispiel dafür seien die Vernehmlassungen, die der Bund lanciere, erklärt Brun: Hier gäbe es schon länger digitales Verbesserungspotenzial. Die Vernehmlassungen werden immer noch auf konventionellen Kanälen wie Post oder E-Mail durchgeführt, obwohl es bereits gute digitale Lösungen für die E-Mitwirkung gäbe.
«Das wäre ein Beispiel, wo ohne Risiko mit der Digitalisierung vorwärtsgemacht werden könnte», so der Schwyzer Staatsschreiber: «Das Gleiche gilt auch bezüglich der Vorbereitung für die Nationalratswahlen. Auch hier greift die Digitalisierung noch zu wenig.» Aus diesem Grund seien die Zentralschweizer Staatsschreiber in einer gemeinsamen Aktion schonnachdenletztenNationalratswahlen aktiv geworden. «Wir haben Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet und bei der Bundeskanzlei eingereicht.» Noch sei aber eine Antwort offen.
Abstimmung statt Abbruch Ob E-Voting eingeführt werden soll, ist eine grundlegende Entscheidung für die Schweizer Demokratie. Deshalb hat der Schwyzer Regierungsrat in seiner Vernehmlassung auch darauf hingewiesen, dass er in dieser Frage eine politische Grundsatzentscheidung des Schweizer Stimmvolks begrüssen würde. Der Lockdown hat das Zustandekommen der Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium und den damit verbundenen politischen Grundsatzentscheid verhindert. E-Voting sorgt im Kanton Schwyz bereits seit 2016 immer wieder für Diskussionen im Parlament.
2019 scheiterte der Vorderthaler SVP-Kantonsrat Beni Diethelm aber mit seiner Forderung, mittels Standesinitiative einen Übungsabbruch für das E-Voting zu fordern. Das Parlament folgte der Schwyzer Regierung, die sich ebenfalls gegen eine Standesinitiative wehrte. Die Regierung stimmte zwar den darin aufgeführten Argumenten zu, hielt eine Standesinitiative aber nicht für den richtigen Weg. Der Ball liege nämlich beim Bundesrat und nicht beim eidgenössischen Parlament, wurde von der Regierungsbank damals argumentiert.






