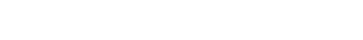Tausend Mal Missbrauch in der katholischen Kirche – gefunden in Geheimarchiven der Bischöfe


Ein Jahr lang forscht ein Team der Uni Zürich zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Das Resultat ist erschreckend. Über Jahrzehnte treiben pädophile Priester in der Schweiz ihr Unwesen. Die Kirchenoberen vertuschen systematisch – bis heute.
Erstmals wurde einem unabhängigen Forschungsteam ermöglicht, in kirchlichen Archiven Akten über sexuellen Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche einzusehen. Die Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich belegen 1002 Fälle sexuellen Missbrauchs, die katholische Kleriker, kirchliche Angestellte und Ordensangehörige seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz begangen haben. Sie untersuchten zudem den Umgang katholischer Würdenträger mit Fällen sexuellen Missbrauchs sowie die Verfügbarkeit und Aussagekraft der Quellenbestände. Damit ist die Basis für weitere Forschung gelegt.
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK), die Konferenz der Ordensgemeinschaften und anderer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens in der Schweiz (KOVOS) und die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) haben das Historische Seminar der Universität Zürich damit beauftragt, sexuellen Missbrauch im Umfeld der römisch-katholischen Kirche seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu erforschen. Gespräche mit von sexuellem Missbrauch Betroffenen geführt In einer einjährigen Pilotstudie hat ein vierköpfiges Forschungsteam unter der Leitung der Professorinnen Monika Dommann und Marietta Meier die Thematik untersucht. Einbezogen wurden nicht nur sämtliche Diözesen in allen Sprachregionen der Schweiz, sondern auch die staatskirchenrechtlichen Strukturen und die Ordensgemeinschaften. Damit wurde die katholische Kirche in der Schweiz als Ganzes in den Blick genommen. Bis auf einige Ausnahmen wurden dem Projektteam die notwendigen Zugänge zu den Archiven ohne grössere Hürden ermöglicht. Zudem wurden zahlreiche Gespräche mit von sexuellem Missbrauch Betroffenen und weiteren Personen geführt.
Das Forschungsteam hat Belege für ein grosses Spektrum an Fällen sexuellen Missbrauchs gefunden – von problematischen Grenzüberschreitungen bis hin zu schwersten, systematischen Missbräuchen, die über Jahre hinweg andauerten. Insgesamt wurden 1002 Fälle, 510 Beschuldigte und 921 Betroffene identifiziert. In 39 Prozent der Fälle war die betroffene Person weiblichen Geschlechts, in knapp 56 Prozent männlich. Bei 5 Prozent liess sich das Geschlecht in den Quellen nicht eindeutig feststellen.
Die Spitze des Eisbergs Die Beschuldigten waren bis auf wenige Ausnahmen Männer. Von den Akten, die während des Pilotprojektes ausgewertet wurden, zeugten 74 Prozent von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen. 14 Prozent betrafen Erwachsene und in 12 Prozent der Fälle war das Alter nicht eindeutig feststellbar.
«Bei den identifizierten Fällen handelt es sich zweifellos nur um die Spitze des Eisbergs», erklären Monika Dommann und Marietta Meier an der Pressekonferenz in Zürich. Zahlreiche Archive, in denen weitere Fälle von Missbrauch dokumentiert sein dürften, konnten noch nicht ausgewertet werden, etwa Archive von Ordensgemeinschaften, Dokumente diözesaner Gremien und die Archivbestände katholischer Schulen, Internate und Heime sowie staatliche Archive. Die Vernichtung von Akten kann für zwei Diözesen belegt werden. Darüber hinaus lässt sich beweisen, dass nicht alle Meldungen konsequent schriftlich festgehalten und archiviert wurden. «Angesichts der Erkenntnisse aus der Dunkelfeldforschung gehen wir davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Fälle überhaupt jemals gemeldet wurde», so die Forscherinnen.
Sexueller Missbrauch in der pastoralen Arbeit Im Bericht werden drei soziale Räume mit spezifischen Machtkonstellationen herausgearbeitet, in denen es zu sexuellem Missbrauch kam: In den ausgewerteten Fällen war die Pastorale mit deutlich über fünfzig Prozent der soziale Raum mit den meisten Fällen sexuellen Missbrauchs. Gewisse Teilbereiche der Pastoral waren besonders anfällig: die Seelsorge (Situationen wie Beichtgespräche oder Beratungen), der Ministrantendienst und der Religionsunterricht. Auch die Tätigkeit von Priestern im Rahmen von Kinderund Jugendverbänden ist hier zu nennen.
Ungefähr dreissig Prozent der ausgewerteten Fälle sexuellen Missbrauchs wurden in katholischen Heimen, Schulen, Internaten und ähnlichen Anstalten verübt. Ein drittes Feld bilden Orden und ähnliche Gemeinschaften sowie neue geistliche Gemeinschaften und Bewegungen (knapp zwei Prozent der ausgewerteten Fälle). In diesem Bereich gestaltete sich die Quellensuche besonders schwierig. Systematische Vertuschung durch die Kirche Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist im Kirchenrecht seit Langem ein schwerwiegender Straftatbestand. «In den ausgewerteten Fällen wurde das kirchliche Strafrecht aber über weite Strecken des Untersuchungszeitraums kaum angewandt. Stattdessen wurden zahlreiche Fälle verschwiegen, vertuscht oder bagatellisiert», so die Forschenden. Kirchliche Verantwortungsträger versetzten beschuldigte und überführte Kleriker systematisch, mitunter auch ins Ausland, um eine weltliche Strafverfolgung zu vermeiden und einen weiteren Einsatz der Kleriker zu ermöglichen. Dabei wurden die Interessen der katholischen Kirche und ihrer Würdenträger über das Wohl und den Schutz von Gemeindemitgliedern gestellt.
In zukünftigen Projekten müssen gemäss dem Forschungsteam weitere Archivbestände konsultiert und die Datenbasis ausgebaut werden. Auf diese Weise werden sich detailliertere Aussagen über die quantitative Dimension sexuellen Missbrauchs sowie zeitliche und geografische Häufungen machen lassen.
Weitere Forschung notwendig
Zukünftig genauer untersucht werden sollte unter anderem die Mitverantwortung des Staates, vor allem im sozialkaritativen und pädagogischen Bereich, weil hier besonders in katholischen Gebieten oft Aufgaben an die Kirche delegiert wurden.
Ein weiterer Fokus ist schliesslich auf die Frage nach den katholischen Spezifika zu legen, die sexuellen Missbrauch im Umfeld der Kirche allenfalls begünstigt haben. Dazu gehören beispielsweise die Sexualmoral, der Zölibat, die Geschlechterbilder innerhalb der Kirche sowie ihr ambivalentes Verhältnis zur Homosexualität.
Auch die Eigenheiten des katholischen Milieus, das die beschriebenen Dynamiken des Verschweigens und Verleugnens stillschweigend akzeptiert und teilweise unterstützt hat, sollten weiter erforscht werden.
«Eine grosse Bedeutung wird dabei Aussagen und Berichten von Betroffenen sowie von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zukommen, die den kirchlichen Archivbeständen gegenüberzustellen sind», erklären die beiden Historikerinnen Dommann und Meier.

Jacques Nuoffer, Präsident der Betroffenen-Organisation SAPEC, kritisiert, dass die Kirche viel zu lange die Opfer ignoriert habe.

«Bei den Fällen handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs», sagen die Historikerinnen Marietta Meier (links) und Monika Dommann.

Beat Müller, Leiter Media Relations Uni Zürich, leitet die PK.

Lukas Federer ist einer der Auto-ren des Berichts zum Pilotprojekt.

Vreni Peterer, Präsidentin IG MikU: «Viele werden heute weinen.»

Abt Peter von Sury spricht über die Verantwortung von Ordensleuten.

Lorraine Odier, Mitautorin der Studie, referiert an der PK.

Vanessa Bignasca ist Mitglied des Forschungsteams.